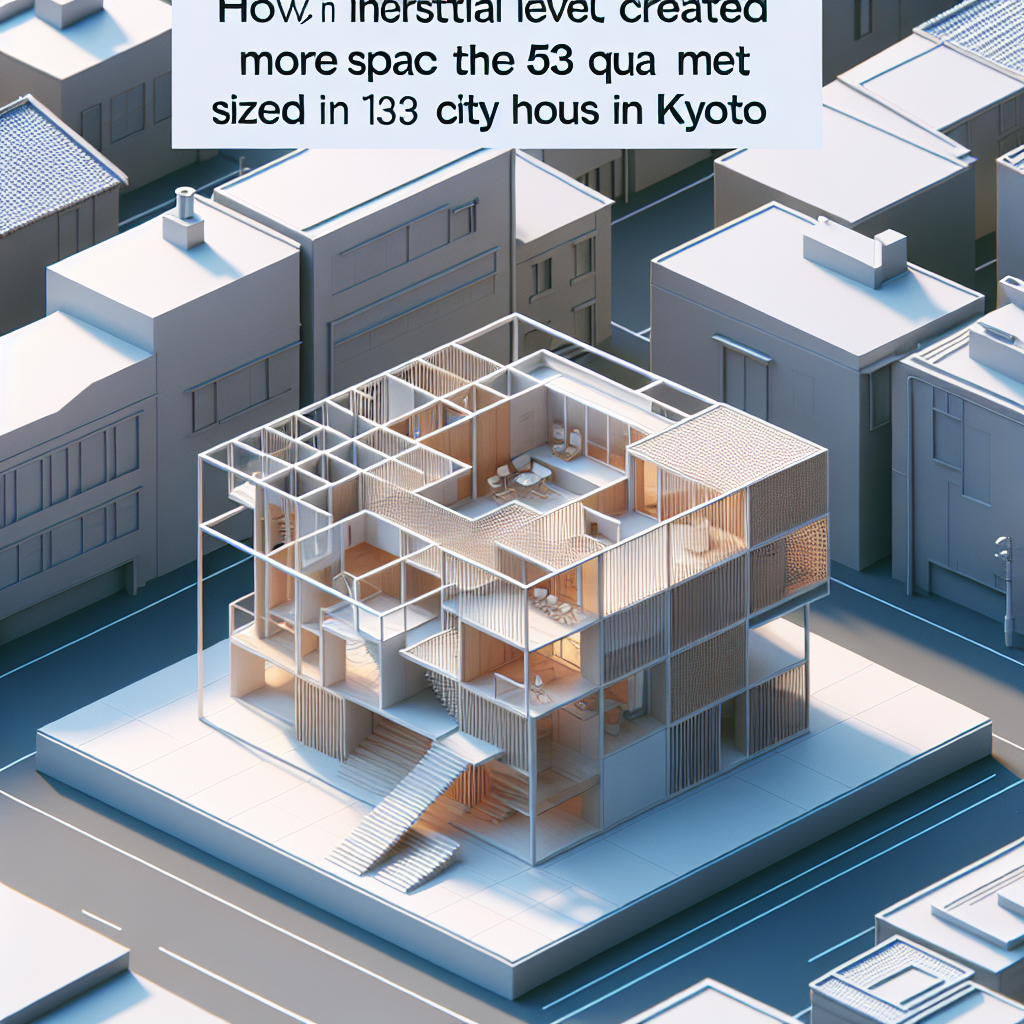Bauen ohne das Klima zu ruinieren: Ein Umdenken ist möglich
Der Bausektor zählt zu den größten Klimasündern weltweit. Knapp 40 Prozent der globalen CO₂-Emissionen entstehen durch Bau- und Gebäudenutzung. Doch muss das wirklich so sein? Die Antwort lautet: Nein. Nachhaltiges Bauen ist mehr als ein theoretischer Idealzustand – es ist eine praktikable, dringend notwendige Realität. Eine Transformation, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile mit sich bringt. In diesem Blogbeitrag werfen wir einen genauen Blick auf das Thema und zeigen, wie eine klimafreundliche Zukunft des Bauens möglich ist.
Der Original-Artikel von Der Standard mit dem Titel „Bauen muss das Klima nicht ruinieren“ zeigt eindrücklich, wie dringend ein Wandel in der Bauwirtschaft notwendig ist: Zum Artikel.
Warum der Bausektor ein Klimakiller ist
Beim Thema Klimaschutz denken viele Menschen zunächst an Verkehr und Energiewirtschaft. Doch der Bausektor wird häufig übersehen, obwohl er enorme Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Ursachen liegen in der energie- und ressourcenintensiven Herstellung von Baustoffen wie Zement, Stahl und Glas sowie im immensen Energieverbrauch von Gebäuden während ihrer Nutzungsdauer.
- Herstellung von Baustoffen erfolgt oft unter CO₂-intensiven Bedingungen
- Große Mengen an Abfällen durch Abriss oder unsachgemäße Entsorgung
- Fehlende Kreislaufwirtschaft erschwert Wiederverwendung von Materialien
- Wohn- und Bürogebäude verursachen rund 30 Prozent des Energieverbrauchs
Ein neuer Weg: Nachhaltige Baupraxis
Nachhaltiges Bauen setzt auf intelligente Planung, umweltschonende Materialien und langfristige Nutzungskonzepte. Dies beginnt bereits bei der Wahl des richtigen Baugrundstücks und reicht bis hin zur Nachnutzung von Gebäuden. Folgende Prinzipien machen nachhaltiges Bauen aus:
- Ressourcenschonung: Nutzung lokal verfügbarer und recyclingfähiger Baustoffe
- Energieeffizienz: Minimierung des Primärenergiebedarfs durch Dämmung, Photovoltaik und Wärmepumpen
- Langlebigkeit: Planung für eine mehrgenerationale Nutzung
- Flexibilität: Adaptive Raumkonzepte für wechselnde Anforderungen
- Bewusster Rückbau: Viele Materialien sollen wiederverwendet werden können
Innovative Materialien und Techniken im ökologischen Bauen
Ein Umdenken in der Materialwahl ist essenziell, um die ökologischen Auswirkungen des Bauens zu minimieren. Holz erlebt als natürlicher Baustoff eine Renaissance, ergänzt durch recycelte Ziegelsteine, Lehm, Stroh oder neue Technologien wie Carbonbeton. Diese Innovationen zeichnen sich durch geringere CO₂-Emissionen, lange Haltbarkeit und gute Wärmedämmung aus.
Auch in der Gebäudetechnik gibt es bahnbrechende Entwicklungen. Smart Building-Systeme verbessern Energieeffizienz durch intelligente Steuerung von Licht, Heizung und Lüftung. Damit sind Gebäude nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nachhaltiger.
Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zum Erfolg
Ein wesentliches Konzept im nachhaltigen Bauwesen ist die Kreislaufwirtschaft. Anstatt Ressourcen linear zu verbrauchen – also Rohstoffe abzubauen, zu verbauen und später zu entsorgen – geht der Trend hin zur Wiederverwendung von Materialien und Komponenten.
Sogenannte Urban Mining-Konzepte gewinnen an Bedeutung: Hierbei werden alte Gebäude als Rohstoffquelle betrachtet. Fenster, Türen, Metalle und sogar Betonbestandteile können wiederverwendet oder recycelt werden. Ziel ist es, den Verbrauch von Primärressourcen zu minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Klimaneutrales Bauen: Vision oder erreichbares Ziel?
Die Frage nach der Machbarkeit von klimaneutralem Bauen stellt sich zu Recht. Doch Pilotprojekte zeigen, dass dies keinesfalls ein unrealistisches Ziel ist. So entstehen europaweit bereits klimapositive Gebäude, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Dies wird durch eine Kombination aus Energieeffizienz, intelligenter Architektur und regenerativen Energien möglich gemacht.
Auch Förderprogramme und gesetzliche Vorgaben beeinflussen diese Entwicklung positiv. Die EU-Taxonomie beispielsweise schreibt spezifische Umweltkriterien für Bauprojekte vor, um Investitionen in grüne Technologien zu lenken.
Beispielhafte Projekte des nachhaltigen Bauens
Holzbauten in urbanen Räumen, wie das HoHo in Wien – eines der höchsten Holzhochhäuser der Welt –, zeigen, wie auch große Bauprojekte mit umweltfreundlichen Materialien realisiert werden können. Auch modulare Bauweisen gewinnen an Relevanz, etwa im sozialen Wohnbau oder bei temporären Unterkünften.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Initiativen: Passivhäuser, Tiny Homes mit Solarstromversorgung oder energieautarke Bürogebäude zeigen, wie die Vision von nachhaltigem Bauen bereits Realität wird.
Der unterschätzte Beitrag der Architektur zur Nachhaltigkeit
Architekt:innen spielen im nachhaltigen Bauen eine zentrale Rolle. Sie entscheiden über Materialien, Raumkonzepte und Bauweise. Moderne Architektur betrachtet nicht mehr nur Form und Funktion, sondern auch ökologische Verantwortung. Dabei entstehen Gebäude, die sowohl ästhetisch als auch klimaschonend sind.
Ein gelungenes Beispiel ist die Integration von natürlichen Materialien, wie Holz, Stein und Glas, in einem möglichst energieeffizienten Gesamtkonzept. Solche Gebäude fördern das Wohnklima, sparen Kosten und schonen die Umwelt.
Ästhetik und Nachhaltigkeit: Kein Widerspruch mehr
Lange Zeit galten nachhaltige Gebäude als funktional, aber wenig attraktiv. Diese Ansicht hat sich grundlegend geändert. Heute zeigen viele Gebäude, dass Nachhaltigkeit mit klarer Formsprache, lichtdurchfluteten Räumen und moderner Eleganz einhergehen kann. Hier kommen auch Bauelemente wie Glasschiebetüren ins Spiel – sie kombinieren Funktionalität und Design, lassen Tageslicht ungehindert fluten und helfen dabei, den Energiebedarf zu optimieren.
Insbesondere in nachhaltigen Wohnkonzepten bieten Glasschiebetüren klare Vorteile: Sie schaffen fließende Übergänge, trennen und verbinden zugleich Räume und sorgen für eine offene, lichtdurchflutete Atmosphäre, die sich positiv auf das Raumklima auswirkt.
Herausforderungen auf dem Weg zur Bauwende
Trotz aller Fortschritte gibt es noch viele Hindernisse auf dem Weg zum klimafreundlichen Bauen.
- Regulatorische Hürden: Baurecht, Normen und Ausschreibungsregularien sind oft veraltet
- Kosten: Nachhaltige Materialien und Technologien sind (noch) teurer in der Anschaffung
- Fachkräftemangel: Mangel an qualifizierten Planer:innen und Handwerker:innen mit „grünem“ Know-how
- Fehlende Bewusstseinsbildung: Nachhaltigkeit steht nicht immer im Fokus von Bauherren oder Investoren